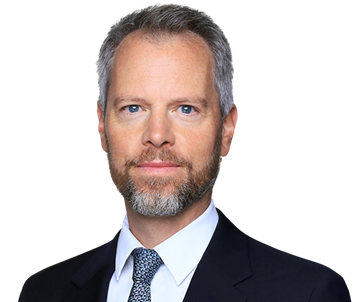Briefing
ESG-Briefing Serie: Das Den Haager Shell-Urteil und seine Bedeutung für deutsche Unternehmen
Anmerkungen zu ESG-Litigation
Nachdem am 26. Mai 2021 Royal Dutch Shell (Shell) durch das Den Haager Bezirksgericht in erster Instanz zur Reduzierung ihrer gruppenweiten CO2-Emissionen verurteilt wurde, haben die Diskussionen über mögliche parallele Verfahren in Deutschland begonnen.
In diesem Client Briefing möchten wir Ihnen daher kurz die Entscheidung des niederländischen Gerichts zusammenfassen, die potentielle Bedeutung für deutsche Unternehmen skizzieren und die Entscheidung in den breiteren Kontext der ESG-Litigation stellen.
Shell-Urteil
Mehrere niederländische NGOs, darunter Milieudefensie und Greenpeace Nederland, sowie 17.000 niederländische Staatsbürger klagten vor dem Den Haager Gericht gegen die Konzernobergesellschaft von Shell auf Reduzierung ihrer CO2-Emissionen. Hieraufhin wurde Shell am 26. Mai 2021 verurteilt, die von ihr verantworteten CO2-Emissionen bis zum 31.12.2030 um 45 % Prozent (im Vergleich zum Stand von 2019) zu reduzieren.
Das Gericht rekurriert in seiner Urteilsbegründung u.a. auf die sog. Urgenda-Entscheidung des niederländischen Obersten Gerichtshofs von 2019, der feststellte, dass bisherige Maßnahmen der niederländischen Regierung zur Verringerung von Treibhausgasen unzureichend seien. Insgesamt bildet das Gericht in seiner Entscheidung diverse Klimaabkommen ab (Erklärung von Stockholm von 1972, UN-Klimarahmenkonvention von 1992, Pariser Klimaabkommen von 2016), um sich eine quantitative Argumentationsbasis zu bereiten. Inhaltlich bezieht sich das Gericht auch auf verschiedene Aussagen und Berichte von Shell zu ihren selbstverpflichtenden Klimazielen und -strategien, inkl. der Group Policies, Sustainability Reports, Entscheidungen zur Vorstandsvergütung sowie Investitionsgrundsätze.
Die Kernaussagen des Gerichts können wie folgt zusammengefasst werden:
Shell obliege nach niederländischem Recht eine (ungeschriebene) „Sorgfaltspflicht“ hinsichtlich der Reduzierung von CO2-Emissionen. Zwar trage Shell keine Alleinverantwortung für den Klimawandel, sie trage aber maßgeblich (im Sinne einer kumulativen Kausalität) hierzu bei. Die (nach niederländischem Recht ungeschriebene) Sorgfaltspflicht werde durch internationale Menschenrechtsabkommen sowie internationale Soft Law-Standards ausgefüllt. Konkret bezieht das Gericht das Recht auf Leben (Art. 2 EMRK und Art. 6 Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte) und das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens sowie das Verbot von Eingriffen in dieses (Art. 8 EMRK und Art. 17 Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte) sowie als Soft Law-Instrumente die UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) und die OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen ein. Das Gericht stellt klar, dass Private sich im Grundsatz nicht auf Menschenrechte berufen können, diese jedoch über die (ungeschriebene) Sorgfaltspflicht in das niederländische Privatrecht hineinreichen. Es führt ausdrücklich aus, dass ein weitgehender Konsens darüber herrsche, dass Unternehmen international anerkannte Menschenrechte zu respektieren haben und dass Menschenrechte auch als Schutz vor den Auswirkungen des schädlichen Klimawandels dienen. Im Lichte der universellen Geltung der UNGP sei es sogar unbeachtlich, ob Shell sich selbst anerkennend der Einhaltung der UNGP unterworfen habe (was hier sogar der Fall ist).
Shell sei somit konkret verpflichtet, den CO2-Ausstoß in ihrem Geschäftsbereich (inkl. Tochtergesellschaften) zu reduzieren sowie sich zu bemühen, diesen bei ihren Geschäftspartnern sowie ihren Endverbrauchern zu minimieren; die Mittel zur Erreichung dieser Ziele stünden im Ermessen von Shell.
Die vorgebrachten Einwände von Shell, wonach die Begründung einer solchen Verpflichtung zuvörderst die Aufgabe der Politik sei, zu Wettbewerbsverzerrungen führe, die Teilnahme von Shell am EU Emissions Trading System unberücksichtigt lasse oder insgesamt in Bezug auf die globale Risikolage unverhältnismäßig sei, wies das Gericht zurück. Insbesondere überschreite das Gericht im Gefüge der Gewaltenteilung nicht seine Kompetenz als Teil der Judikative gegenüber der Legislative.
Bedeutung für deutsche Unternehmen
Im Grundsatz gilt selbstverständlich, dass Urteile nur inter partes-Wirkung erzeugen, d.h. nur die an dem Rechtsstreit beteiligten Parteien rechtlich binden. Ausstrahlungswirkung und ein gewisses Potential, auch deutschen Richtern Argumentationsmaterial zu liefern, ist der niederländischen Entscheidung hingegen nicht abzusprechen.
Denn immerhin könnten für die Heranziehung von sog. Soft Law-Standards auch im deutschen Recht Einfallstore gefunden werden. Diese liegen zum einen auf Ebene der Pflichtverletzung im deliktischen Schadensrecht (insbesondere im Rahmen von § 823 Abs. 1 BGB), zum anderen aber auch auf der Ebene des Haftungsmaßstabs in Form der Konkretisierung von Fahrlässigkeitsvorwürfen (Bestimmung des Sorgfaltsmaßstabs).
Schon seit geraumer Zeit ist zu beobachten, wie Soft Law im deutschen Recht zur Ausgestaltung und Konturierung von sog. Hard Law herangezogen wird. Als ein Beispiel kann das Lauterkeitsrecht genannt werden, über dessen Generalklausel beispielsweise internationale Sozialstandards der ILO-Konventionen, sofern sich diesen unternehmensseitig unterworfen wird, in das einfache Recht hineinwirken. Gleichfalls werden bereits im Umwelt- und Arbeitsrecht unverbindliche internationale Standards (wie etwa Berichte zur Europäischen Sozialcharta) zur Argumentation und bei der Auslegung von Normen herangezogen. Bereits im Jahre 2006 hatte zudem das Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung im Zusammenhang mit Maßnahmen des Jugendstrafvollzugs eine regelmäßige Indizwirkung von Soft Law-Instrumenten im Bereich der Menschenrechte festgestellt und dies in folgenden Entscheidungen zu Haftbedingungen und im Betreuungsrecht fortgeführt. Eine dogmatische Begründung blieb zwar aus, allerdings wird in der Literatur überwiegend versucht, dies argumentativ mit der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes zu untermauern.
Im Lichte des niederländischen Urteils ist hervorzuheben, dass gerade die Berufung auf die UNGP und die OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen eine Fülle denkbarer Beschwerdekonstellationen mit sich bringen, die weit über den Klimaschutz hinausgehen, nämlich die volle Bandbreite international anerkannter Menschenrechte abdecken. Dieser Bereich stellt gerade den originären Anwendungsbereich der UNGP dar, die an sich nämlich keine umweltrechtlichen, sondern menschenrechtliche Sorgfaltspflichten statuieren.
Die geführte Diskussion über den (teilweisen) Ausschluss einer zivilrechtlichen Haftung nach dem nunmehr verabschiedeten „Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz“ verliert in Anbetracht dieser Gesamtlage in gewissem Umfang an Relevanz.
ESG-Litigation
Ganz augenscheinlich nehmen die Regulierungen auf dem Gebiet „Environmental, Social and Governance“, kurz ESG, weiter zu. In gleichem Maße nimmt auch die Anzahl an Rechtstreitigkeiten vor dem Hintergrund von ESG-Belangen zu.
Besonderes Augenmerk fällt insofern auf die steigende Zahl an „Klimaklagen“ vor Gerichten. Hierzu zählen nicht zuletzt die Verfassungsbeschwerden gegen das Klimaschutzgesetz vor dem deutschen Bundesverfassungsgericht und der daraufhin ergangene Beschluss zur (tlw.) Verfassungswidrigkeit dieses Gesetzes, sondern auch die Klagen bzw. Beschwerden vor internationalen Gerichten (wie dem EuGH oder dem EGMR), mit denen über die Argumentation von Grundrechtsverletzungen die staatlichen bzw. supranationalen (EU) Klimaschutzziele einer gerichtlichen Kontrolle unterzogen werden sollen. Die Verknüpfung von umweltrechtlichen Themen mit Menschenrechten ist im Völkerrecht gewiss nicht neu, gewinnt allerdings nach den letzten Gerichtsentscheidungen deutlich mehr an Gewicht und bietet somit ein breiteres Spektrum an Anknüpfungspunkten für klimaschutzbezogene Klagen. Auch das Bundesverfassungsgericht verknüpfte letztlich im Beschluss zum Klimaschutzgesetz die staatlichen Schutzpflichten vor dem Klimawandel mit den (Freiheits-) Grundrechten künftiger Generationen.
In diesem Zusammenhang kommt zahlreichen Akteuren bei der ESG-Litigation eine große Bedeutung zu, die sich nicht nur auf das Gebiet zivilrechtlicher Streitigkeiten begrenzen lässt, sondern (künftig) gleichermaßen auch verwaltungsrechtliche und strafrechtliche Risiken mit sich bringen wird bzw. bereits mit sich bringt.
Die relevantesten Akteure sind hierbei (nicht abschließend):

NGOs und andere Kläger werden auch in Deutschland – in der Hoffnung, auf ähnlich „aktivistische“ Richter wie in den Niederlanden zu treffen – Prozesse anstreben. Ob diese den Forderungen und teilweise eher abseitigen rechtlichen Argumenten dieser Akteure aufgeschlossen gegenüberstehen, so dass eine richterliche Rechtsfortbildung in Betracht kommt, wird sich in Zukunft zeigen.
Im Rahmen der internationalen ESG-Litigation, speziell im Bereich der menschenrechtlichen Verantwortung von Unternehmen, ist ferner ein wichtiger Aspekt für das Gesellschaftsrecht nicht aus dem Blick zu verlieren: Die Fortentwicklung der Verantwortlichkeit von Konzernobergesellschaften für das Handeln ihrer Tochtergesellschaften (über die Begründung einer „duty of care“ der Obergesellschaft). Besonders prominent wurde dies in zwei Entscheidungen des UK Supreme Court besprochen (Lungowe v. Vedanta, 2019; Okpabi v Royal Dutch Shell Plc, 2021) sowie in einer weiteren niederländischen Entscheidung zu Beginn dieses Jahres gegen Shell und ihre nigerianische Tochtergesellschaft durch den The Hague Court of Appeals (Four Nigerian Farmers and Milieudefensie v. Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd and Royal Dutch Shell Plc, 2021). Diese Entscheidungen zeitigen überdies Relevanz für die Ausgestaltung von (konzern-zentralen) Compliance-Systemen und die notwendige Sorgfalt bei der Implementierung gruppenweiter Policies, welche u.a. zur Begründung des Bestehens einer duty of care herangezogen werden.
Zusammenfassend festzuhalten ist somit, dass menschenrechtliche Soft Law-Standards in ihrer originären Form zwar rechtlich nicht verbindlich sind, es ihnen aber keineswegs an rechtlicher Relevanz fehlt.